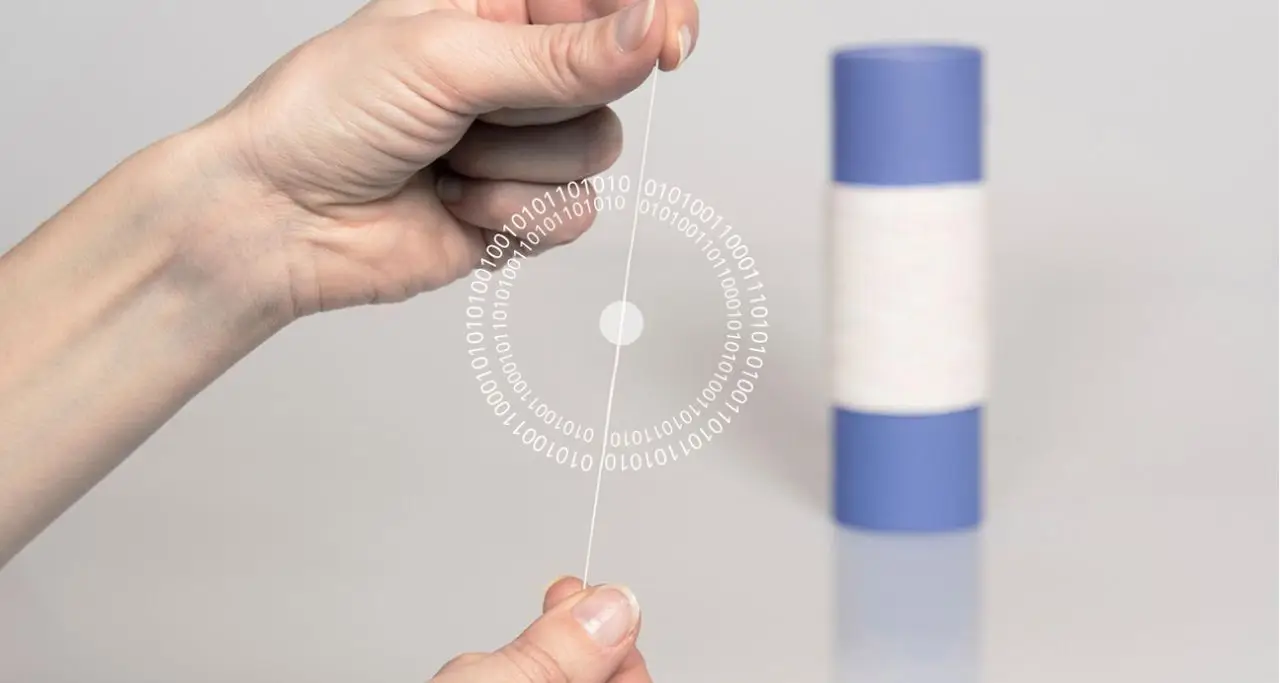- Wi‑Fi HaLow bietet größere Reichweite und IP‑fähige, bidirektionale Kommunikation zwischen WLAN und klassischen LPWANs.
- Regulatorische Einschränkungen im 868‑MHz‑Band (Bandbreitenbegrenzung, Duty‑Cycle) limitieren die Nutzung in Deutschland und Europa.
- Die Technologie ergänzt, ersetzt aber nicht grundsätzlich etablierte LPWANs wie LoRaWAN oder Mioty.
- Verbreitung in Asien und den USA ist stärker aufgrund flexiblerer Frequenzpolitik und industrieller Dynamik.
- IMST unterstützt Kunden mit Entwicklung, Antennendesign und Evaluierungen, bietet aber keine massenmarktfertigen HaLow‑Infrastrukturen an.
Wi-Fi HaLow gilt als spannende Ergänzung im Wireless-Portfolio: Reichweiten von bis zu einem Kilometer, IP-Kompatibilität und geringe Energieaufnahme machen die Technologie besonders für IoT-Anwendungen interessant. Was kann Wi-Fi HaLow – und warum ist die Technologie in Asien und den USA schon weiter? Wie groß ist das Marktpotenzial in Europa – und was steht einer breiten Einführung im Weg?
Wir haben mit dem Experten Dr. Daniel Martini über Chancen, regulatorische Hürden und mögliche Einsatzszenarien gesprochen. Er ist Teamleiter Systems Engineering beim -Unternehmen IMST mit Sitz in Kamp-Lintfort.
Interview mit Daniel Martini
Wie viel Potenzial hat Wi-Fi HaLow?
Dr. Daniel Martini: Wi-Fi HaLow ist eine noch junge Technologie, die eine Lücke zwischen klassischen WLANs und LPWANs wie LoRaWAN oder LTE-M füllt. Die Reichweite liegt bei rund einem Kilometer – deutlich mehr als bei herkömmlichem WLAN, aber unterhalb typischer Mobilfunkstandards.
Ein direkter Ersatz für andere Technologien ist HaLow nicht, dennoch hat es Potenzial, neue Einsatzbereiche zu erschließen – etwa im Smart Home, Smart City oder Automotive-Umfeld. Die IP-Kompatibilität und die vertrauten WLAN-Sicherheitsstandards machen die Technologie besonders interessant für bidirektionale Kommunikation.
In Deutschland und Europa gibt es allerdings regulatorische Hürden: Die Nutzung im 868-MHz-Band ist durch Bandbreitenbegrenzung und Duty-Cycle-Vorgaben stark eingeschränkt. Der Standard unterstützt eigentlich Kanal-Bandbreiten bis zu 10 MHz – hierzulande sind jedoch nur vier 1-MHz- oder maximal zwei 2-MHz-Kanäle möglich. Diese Einschränkungen könnten eine breite Marktadoption hemmen.
Dr. Daniel Martini - Team Lead Systems Engineering
In Asien und den USA ist Wi-Fi HaLow bereits weiter verbreitet – unter anderem aufgrund flexiblerer Frequenzpolitik. Ob sich die Technologie auch in Europa durchsetzt, hängt stark von regulatorischen Entwicklungen und konkreten Anwendungen ab.
Könnte sich die Frequenznutzung in Europa noch erweitern?
Das ist ein langwieriger und komplexer Prozess, der in Deutschland in den Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur fällt. Denkbar wäre eine Neuzuweisung ungenutzter Frequenzbereiche – beispielsweise aus dem Rundfunkbereich. Konkrete Bestrebungen sind uns derzeit aber nicht bekannt.
Warum ist Wi-Fi HaLow in Asien und den USA weiter verbreitet?
Das hat vor allem historische und regulatorische Gründe. Frequenzvergabe ist in Europa stark reguliert und von zahlreichen Interessensgruppen abhängig. In anderen Regionen gibt es mehr Handlungsspielraum, auch durch stärkeren politischen oder industriellen Druck großer Marktakteure. Für Veränderungen braucht es hierzulande engagierte Player, die das Thema aktiv in die zuständigen Gremien tragen.
Ist Wi-Fi HaLow bereits in der Praxis angekommen?
In unserem Umfeld bisher nicht. Bei uns dominieren aktuell andere LPWAN-Technologien wie LoRaWAN, Mioty oder Wi-SUN. Erste Wi-Fi-HaLow-Chipsätze sind zwar verfügbar, aber noch recht teuer. Der Durchbruch in Europa wird durch die erwähnten Einschränkungen gebremst. Große Stückzahlen und konkrete Anwendungen könnten das in Zukunft ändern – bislang sehen wir jedoch noch keine starke Nachfrage.
Wie positioniert sich Wi-Fi HaLow im Vergleich zu anderen LPWAN-Technologien?
Wi-Fi HaLow überzeugt durch höhere Datenraten, IP-Fähigkeit und bidirektionale Kommunikation. Damit eignet es sich für Anwendungen, bei denen nicht nur Sensordaten gesammelt, sondern auch Aktoren angesteuert werden – etwa im Smart Home, der Agrartechnik oder bei Videoübertragungen.
In klassischen Sensornetzwerken oder im Metering, wo hohe Reichweite bei niedriger Datenrate gefragt ist, haben etablierte LPWANs wie LoRaWAN klare Vorteile. HaLow schließt hier keine Lücke, sondern ergänzt bestehende Lösungen – vor allem dort, wo Reichweite, Datenrate und IP-Kompatibilität gleichzeitig gefragt sind.
Welche Anwendungen sind denkbar?
Überall dort, wo eine bidirektionale Kommunikation mit Aktoren erforderlich ist – etwa in der Industrieautomation, in landwirtschaftlichen Steuerungssystemen oder im Smart Home. Auch für Smart-City-Anwendungen ist HaLow interessant, sofern eine entsprechende Infrastruktur besteht. Allerdings muss die reale Reichweite von einem Kilometer im urbanen Umfeld kritisch betrachtet werden – Hindernisse wie Gebäude schränken die Performance stark ein.
Dr. Daniel Martini - Team Lead Systems Engineering
Für einfache Sensornetzwerke ist Wi-Fi HaLow aus unserer Sicht weniger geeignet. Dort dominieren Technologien mit höherer Reichweite und geringerer Datenrate. HaLow ist eher eine Erweiterung im Bereich zwischen Bluetooth LE und klassischem WLAN.
Hat HaLow das Potenzial, Wireless M-Bus im Smart Metering zu verdrängen?
Eher nicht. Im Smart-Metering-Sektor haben sich andere Standards – etwa LoRaWAN, Mioty oder Wireless M-Bus/OMS – bereits etabliert. HaLow bietet dort aktuell keinen entscheidenden Vorteil.
Was bietet IMST im Bereich Wi-Fi HaLow an?
Wir verstehen uns primär als Entwicklungs- und Dienstleistungspartner. Zwar bieten wir auch einzelne Funkmodule und Evaluation Boards an, unser Schwerpunkt liegt aber auf kundenspezifischen Lösungen: Wir unterstützen von der Konzeptphase über das Antennendesign und die Hochfrequenztechnik bis zur Integration in bestehende Systeme. Bei Bedarf evaluieren wir auch Wi-Fi HaLow – je nach Anforderung des Kunden.
Welche Wireless-Technologien sind derzeit besonders gefragt?
Unsere Projekte sind extrem vielfältig. Wir kommen meist dann ins Spiel, wenn Standardlösungen nicht mehr ausreichen. Das Spektrum reicht von einfachen Funkmodulen für Rauchmelder bis hin zu komplexen phased-array-Systemen für Satellitenkommunikation – von wenigen Megahertz bis über 140 GHz.
Viele Kunden wenden sich an IMST für spezielle Entwicklungen mit Prototypencharakter oder Machbarkeitsstudien – darunter auch individuelle Radarsysteme, maßgeschneiderte Funksysteme oder Sonderlösungen für Maut- und Verkehrstechnik. Unsere Stärke liegt darin, alle Komponenten – vom Antennendesign bis zur Applikationssoftware – aus einer Hand liefern zu können.
Fazit
WiFi-Halow ist eine interessante Ergänzung zu bestehenden WLAN und Bluetooth Systemen. Es verspricht höhere Reichweite und bi-direktionale Kommunikation, vereint mit IP-Fähigkeit und bekannten Sicherheitsmechanismen. In Europa und vor allem in Deutschland könnte dieser Standard aufgrund regulatorischer Randbedingungen allerdings ausgebremst werden. Es wird sich zeigen, wie sich der Markt in der Zukunft entwickelt.
Dr. Daniel Martini - Team Lead Systems Engineering



-über-Wi-Fi-HaLow-responsive.webp)